Trotz dem – über das Hinschauen nach Suizid
Wir haben zum Thema Suizid einen Erfahrungsbericht bekommen – von einer besonders starken Frau: Nicole Schenderlein ist Projektleiterin von Blattwenden, einem Angebot für Suizid-Hinterbliebene. Dazu gehören Kreativzeiten und das Blog www.green-woman.de sowie die Facebookseite www.facebook.de/LuetteLockesLandhuus.
Sie schreibt:
Ich kann nicht garantieren, dass dieser Text nicht pathetisch wird.
Denn die Welt brennt.
Nicht erst, seitdem in Australien Kängurus im Feuer sterben. Auch nicht erst, seitdem Trump bei Twitter für weltweites Sich-Fassungslos-An-den-Kopf-greifen sorgt. Despoten gab es schon immer. Naturkatastrophen gab es schon immer. Update 2020: Und auch Seuchen kennt die Welt, wenn auch nicht wir, die gerade unsere erste Pandemie erfahren…
Doch dank der Medien wissen wir jetzt schneller und mehr darüber Bescheid. Oder auch nicht. Denn der Amazonas brennt ebenfalls. Immer noch. Aber das ist nicht mehr aktuell. Damit hat man sich abgefunden. Oder es vergessen.
Das passiert häufig, wenn man sich ohnmächtig fühlt. Wenn man denkt, dass man sowieso nichts mehr tun kann. Man lässt es los.
Viele schwärmen vom Loslassen.
Ist auch ein gutes Konzept, wenn man schädigende Beziehungen hinter sich lässt, ungesunde Verhaltensmuster, überhaupt die Vergangenheit. Wenn man aber das Alte komplett vom Aktuellen trennt, passiert dasselbe wie mit dem Amazonas: Es hört davon nicht auf zu brennen. Man schaut nur nicht mehr hin.
Bei schlimmen inneren Verletzungen ist nicht Hinsehen auch ein gutes Schutzschild. Fürs erste. Doch der Wald brennt weiter. Vor allem, wenn niemand etwas dagegen tut. Der Brand holt uns irgendwann ein, er kommt nahe an unsere Siedlungen heran, an unser gemütliches Zuhause, das wir uns jahrelang mühsam aufgebaut haben.
Und irgendwann kann es sein, dass ein Funke überspringt. Und uns unser Heim nimmt. Unsere Heimat. Unsere Wildtiere. Vielleicht sogar unsere Haustiere. Vielleicht sogar unsere Lieben, unsere Familie, unsere Kinder.
In diesem Sommer ist es vier Jahre her, dass mein Mann Suizid begangen hat.
Meine Tochter war damals drei Jahre alt. Und ich fühle mich manchmal immer noch wie ein verkohlter Baum, der von innen weiter brennt, obwohl das Feuer längst weg ist.
Mein Mann war querschnittsgelähmt. Ein Jahr zuvor hatte sich sein Motorradunfall gejährt. Zwanzig Jahre saß er da bereits im Rollstuhl. Unser Leben war schon vorher wegen gesundheitlicher und daraus resultierender finanzieller Schwierigkeiten (wer zu pflegende Angehörige hat, weiß, was ich meine) ein einziges Auf und Ab gewesen.
Doch ich war zufrieden. Denn hey – wir hatten doch noch ein Kind bekommen. Wir hatten doch noch aus unserer Bruchbude, an die wir wegen des Rollis gebunden waren (wer barrierefreien Wohnraum sucht, weiß auch, was ich meine) ein einigermaßen akzeptables Zuhause gebastelt. Und wir hatten doch noch aus unserem Leben als Krüppelfamily etwas gemacht, was anderen zu Gute kam: eine Beratungsstelle auf Spendenbasis auf dem platten Land.
Doch Markus, so hieß mein Mann, hatte immer mehr Schwierigkeiten, seinen Zustand anzunehmen.
Ich übrigens auch. Damit meine ich nicht seine Querschnittslähmung. Sondern das Behindert werden. Inklusion ist in Deutschland immer noch ein Reizthema. Heute sogar mehr denn je. Und damit meine ich nicht die schulische Inklusion. Ich meine das inklusive Denken. Dass Menschen, egal wie unterschiedlich sie sind, zusammengehören.
Das Gegenteil von Inklusion macht mürbe.
Zwanzig Jahre Ausgrenzung macht müde. In Markus´ Fall: lebensmüde.
Während ich das schreibe, bin ich wütend. Nicht mehr, weil er Suizid begangen hat. Das war ich lange Zeit. Wütend nicht nur, weil er gegangen ist, obwohl er versprochen hatte, mich bis wir alt und grau sind zu lieben. Auch weil wir gemeinsam ein Kind großziehen wollten. Gemeinsam gearbeitet haben. Und weil er eine versteckte Kaufsucht hatte, die er mir verschwiegen hat. Als er gestorben ist, hatte ich nichts mehr bis auf meine Tochter und das Haus. Kein Cent war mehr auf dem Konto. Stattdessen: Kredite, Kredite, Kredite. Doch meine Wut darauf ist verraucht. Sie durfte raus. Kontrolliert abfackeln. Sie ist fort. Wie die Schulden. Gott sei Dank.
Worüber ich heute wütend bin, ist das Wegsehen. Das Vergessen. Das Ignorieren. Denn es passiert wieder. Jeden Tag neu.
Ich kann das verstehen. Manchmal mag man einfach nicht mehr. Die zusammenstürzenden Twin Tower. Die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer. Die dreisten Twitterdrohungen von Trump. Die weltweiten Erniedrigung von Frauen. Die brennenden Tiere in Australien. Die sozialen Ungerechtigkeiten in Europa. Die drohende Altersarmut. Der tägliche Spagat, Kind und Job unter einen Hut zu bringen. Was für eine Scheiße ist das eigentlich?
Und trotzdem! Never ever würde ich dieses Leben eintauschen wollen gegen den Tod.
Der ist ja ohnehin schon da. Er ist allgegenwärtig. Wir tun nur oft so, als gäbe es ihn nicht, den Sensemann. Weil wir uns Harmonie wünschen.
Unsere eigene kleine Welt mit Häuschen, Garten, lachenden Kindergesichtern. Und unsere einzigen Probleme sind, dass die Kinder nicht durchschlafen, sich ewig in die Länge ziehende Elternabende und vielleicht noch eine holpernde bindungsorientierte Erziehung.
Ich nehme mich auch gar nicht raus, beim Wegschauen. Ich kann das verstehen.
Wir alle wünschen uns das Paradies. Wir alle möchten Frieden und Freude und Eierkuchen. Möglichst vegan. Eben weil die Realität nicht so aussieht.
Die Realität ist: Die meisten Frauen arbeiten halbtags, weil sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, und werden dafür im Alter mit Armut gestraft. Die Wahrheit ist: Der Klimawandel kommt nicht. Er ist schon da. Und bringt immer mehr Naturextreme mit sich. Die Wahrheit ist: Unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr wie vor zwanzig Jahren.
Die Wahrheit ist: Unsere Welt ist im Umbruch. Und das kann Angst machen.
Und bei Angst geschieht Folgendes: Entweder wir rennen weg, wir verstecken uns, oder wir kämpfen.
Nach dem Suizid meines Mannes wäre ich auch am liebsten weggerannt.
Einige tun das. Sie verkaufen alles und fangen woanders wieder neu an. Bis der Brand sie einholt und sie sich doch die Wunden ansehen müssen, vor denen sie davongelaufen sind.
Ich hätte mich auch gerne versteckt. Das geht aber mit Kind nicht so gut. Gott sei Dank. Denn so hatte ich gar keine Chance, ein Opfer zu werden. Wer sich verkriecht, überlässt anderen die Verantwortung. Und verpasst vielleicht die Chance zu Trauern. Doch auch da kommt irgendwann nach Jahren oder Jahrzehnten der Schwelbrand wieder hoch.
Ich will diese zwei Möglichkeiten, mit Suizid oder einer anderen Katastrophe umzugehen, nicht verurteilen. Wie wir auf Angst reagieren, ist oft instinktiv. Wir suchen uns das nicht aus.
Ich bin auch nicht die geborene Kämpfernatur.
Ich bin keine Amazone. Eher der brennende Amazonas.
Denn so ein Suizid tut scheiße weh. Es verkohlt einen von innen heraus. Wer will das schon? Es ist nur allzu verständlich, dass man zunächst handlungsunfähig erstarrt oder in Panik die Flucht ergreift. Doch es macht es nicht einfacher. Denn es brennt weiter. Und Feuer hat Kraft.
Aber. Feuer lässt sich auch löschen.
Wenn wir hinsehen. Wenn wir zugeben, dass es brennt. Wenn wir aktiv werden. Wenn wir Wasser holen. Wenn wir nicht alleine löschen. Wenn wir gemeinsam etwas dagegen tun.
Das geht aber nur, wenn andere hinsehen. Suizid gehört zu den häufigsten Todesursachen. Jedes Jahr sterben mehr Menschen durch Suizid als durch einen Verkehrsunfall. Im Gegensatz zu einem Verkehrsunfall wird über Suizid aber nicht gesprochen. Es wird sogar oft so getan, als hätte es ihn nie gegeben. Weil es so verdammt schmerzhaft ist. Weil der Suizid unsere Lebensumgebung in eine glühend heiße Hölle auf Erden verwandelt. Und das sage ich, obwohl ich (eine nicht sonderlich religiöse) Christin bin. Gott schützt nicht vor harten Zeiten. Aber er geht mit hindurch.
Mein Leben heute ist ganz anders als vor Markus´ Suizid…
Ich lebe immer noch mit meiner Tochter in unserem alten Landhaus, aber zurzeit in einer Baustelle – denn nach zwanzig Jahren in einer von Mäusen bevölkerten Bruchbude wird sie endlich saniert.
Zusammen mit meinem neuen Partner, einem Niederländer, der plötzlich in mein Leben kam wie ein Engel. Passt nicht ganz, dieser Vergleich, weil der Engel zwar Locken hat, aber Atheist ist – aber auch das ist, wie so vieles nach dem Suizid, etwas verrückt.
Ein Leben nach Suizid ist alles andere, aber nicht normal.
In meinem alten Beruf kann ich wegen des Suizids nicht mehr arbeiten. Ich werde umgeschult. Zur Bildhauerin. Und werde in diesem Jahr anfangen, mit anderen Suizid-Hinterbliebenen kreative Wege zu beschreiten, um ihr und unser aller Feuer zu löschen.
Dafür bin ich bei einem Verein als Projektleiterin angestellt. Wieder auf Spendenbasis. Nicht weil ich das so sehr mag. Um ehrlich zu sein, hasse ich das sogar. Dieses ständige Fragen und Bitten. Aber weil es sonst nicht ginge. Weil es bisher keine einzige Stiftung gibt, die sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben hat. Nichtstun ist aber keine Option für mich. Gestorben wird ja eh schon genug. Und wenn es innerlich ist.
Klingt jetzt wie ein Happy End. Ist es aber nicht. Weil es immer noch brennt.
Ein Suizid ist nicht einfach nach einem Jahr Trauerzeit vorbei. Je nachdem wie er passiert ist, können die Umstände traumatisierend sein. Und es kann Jahre dauern, bis man alle Brandherde gefunden und gelöscht hat.
Doch das Umfeld vergisst das. Sie sehen nur den Baum, der sich erholt hat und wieder zaghaft Blätter trägt. Doch selbst wenn der Baum in Flammen steht, schauen viele weg. Weil wir für Suizid noch keine verständliche Sprache haben in unserer Gesellschaft. Und das, obwohl es von uns Hinterbliebenen aufgrund der hohen Sterbezahlen so viele gibt. Sie leben oft schweigend. Und verbrennen unbemerkt von innen.
Mir reicht es nicht, nur zu überleben. Mir geht es ums Leben. Für uns alle.
Und wenn das bedeutet, dass wir auf etwas verzichten müssen. Aufs Wegschauen zum Beispiel. Wenn wir etwas aushalten müssen. Schmerz zum Beispiel.
Damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt alle grämen und selbst geißeln und verzweifeln müssen.
Damit meine ich, dass wir hinsehen, wenn es anderen schlecht geht.
Dass wir diesen Anblick ertragen. Dass wir einander aushalten.
Und dass wir dann aktiv werden. Und kreativ.
Das nennt man dann Inklusion.
Nicht nur von Menschen mit Behinderungen. Nicht nur von Suizidhinterbliebenen.
Ich meine die kleine Welt um uns herum:
Wer bittet um Hilfe? Wer hat zu wenig Kraft, um Hilfe zu bitten? Wer wird vergessen?
Wie können wir helfen? Ohne selbst zugrunde zu gehen? Wie können wir Hilfe organisieren? Wie können wir unser Leben ändern, um wirksam helfen zu können?
Wie können wir gemeinsam um die Ecke denken? Kreative Wege gehen? Neues wagen?
Eigentlich wollte ich einen fröhlichen, hoffnungsvollen Text schreiben. Einen über Kreativität. Wie Kreativität helfen kann, Trauer zu überwinden. Sogar bei Traumata. Wie Kreativität uns einander näher bringt. Und menschlicher macht. Nicht nur Suizid-Hinterbliebene. Uns alle.
Solche Texte kann ich auch. Sogar recht gut. Aber nicht heute. Heute bin ich im Trotz-Modus. Heute wünsche ich mir mehr Trotz für uns alle. Trotz gegen Ausgrenzung. Trotz gegen Unmenschlichkeit. Trotz gegen das Wegsehen.
Denn was wir oft denken, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, stimmt nicht. Dass man sowieso nichts mehr tun kann. Ein Satz, der genutzt wird, wenn Menschen unausweichlich sterben. Doch auch dann kann man noch ganz viel tun. Den Sterbenden in den Arm nehmen. Zeit mit ihm verbringen. In die Augen schauen. Die Hand drücken.
Und vor allem: Nicht wegsehen.
Das ist unendlich kostbar. Denn Menschen, die einen geliebten Menschen durch Suizid verlieren, können genau das nicht mehr.
Jetzt ist der Text doch pathetisch geworden.
Mist.
Und ich kann sonst echt bessere Enden.
Aber ich bleibe trotzdem dabei: Nie aufgeben. Weniger wegsehen.
Und mehr Trotz, bitte.
Nicole
Nicole Schenderlein ist Projektleiterin von Blattwenden, einem Angebot für Suizid-Hinterbliebene. Dazu gehören Kreativzeiten und das Blog www.green-woman.de sowie die Facebookseite www.facebook.de/LuetteLockesLandhuus
Bei Instagram findet ihr sie unter https://instagram.com/green_woman_art. Und wer Nicoles Arbeit unterstützen möchte, bekommt hier weitere Infos:
https://green-woman.de/spenden/
- 16. Jan 2020
- 3 Kommentare
- 8
- Elternteil, Selbstmord, Suizid, Tod Eltern




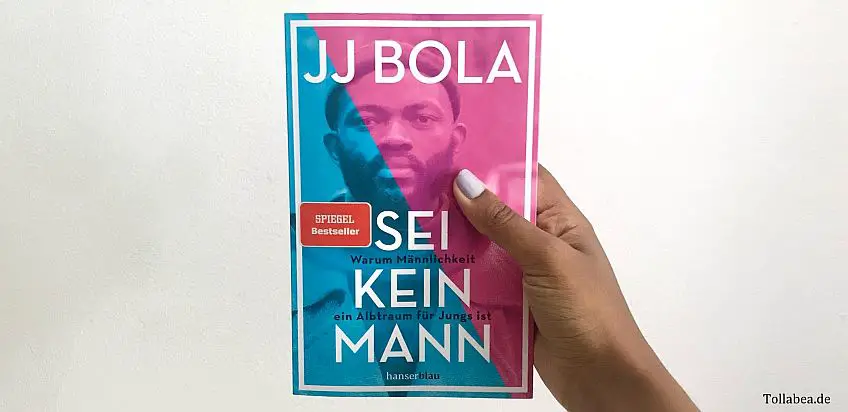








3 Kommentare